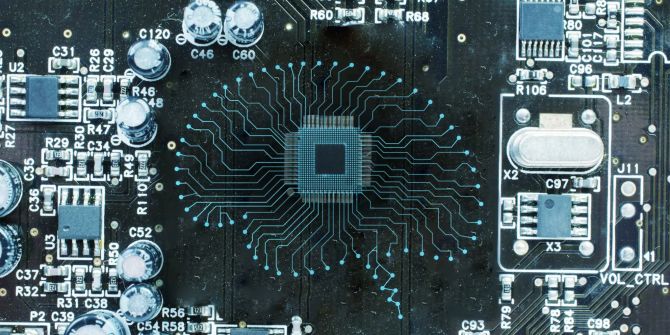Autopilot: Tesla soll 243 Mio. US-Dollar zahlen

Ein richtungsweisendes Urteil gegen Tesla in Florida könnte die Zukunft des autonomen Fahrens grundlegend verändern. Tesla sieht die Zukunft in Gefahr.

Ein US-Gericht hat in einem wegweisenden Urteil den Elektroautohersteller Tesla zur Zahlung von $243 Millionen verurteilt. Die Entscheidung betrifft einen tödlichen Unfall aus dem Jahr 2019, bei dem der Autopilot des Fahrzeugs eine Mitschuld trug.
Dieses Urteil markiert einen seltenen juristischen Rückschlag für Tesla und wirft grundlegende Fragen über die Haftung bei teilautomatisierten Fahrzeugen auf. Es ist ein Präzedenzfall, der weitreichende Konsequenzen für die gesamte Branche des autonomen Fahrens haben könnte.

Das Geschworenengericht in Florida befand, dass sowohl der Fahrer als auch Tesla eine Teilschuld an dem Unglück hatten. Die Jury sprach der Familie des Opfers und einem Überlebenden einen Gesamtschadensersatz von $329 Millionen zu. Davon muss Tesla 33% der Ausgleichszahlungen ($43 Millionen) sowie $200 Millionen Strafschadenersatz leisten.
Der tödliche Unfall und das Urteil
Bei dem Unfall im Jahr 2019 fuhr ein Tesla Model S mit aktiviertem Autopiloten mit hoher Geschwindigkeit über eine Kreuzung mit Stoppschild. Dabei krachte er in einen geparkten Chevrolet Tahoe und traf auch die Besitzer, die neben dem Fahrzeug standen:
Eine 22-jährige Frau wurde getötet, ihr Freund wurde schwer verletzt. Der Fahrer des Tesla gab zu, dass er abgelenkt war, weil er sein heruntergefallenes Handy suchte.
Die Kläger argumentierten erfolgreich, dass Tesla trotz der Ablenkung des Fahrers mitverantwortlich sei, da das Autopilot-System auf der Strasse, auf der es nicht dafür vorgesehen war, nicht deaktiviert wurde. Sie führten zudem an, dass Tesla die Technologie nicht ausreichend sicher gestaltet und das System den Fahrer nicht gewarnt habe.
Die Rolle des Autopiloten und die Haftungsfrage
Die Geschworenen sahen in der Marketingstrategie von Tesla, insbesondere im Gebrauch des Namens «Autopilot», eine Irreführung der Verbraucher. Der Begriff suggeriere eine höhere Autonomie, als das Assistenzsystem tatsächlich besitze, was zu einer Überbewertung der Technologie und einer falschen Sicherheit beim Fahrer führen könne.

Obwohl der Fahrer eine Mitschuld von 67 % zugewiesen bekam, muss er aufgrund einer aussergerichtlichen Einigung mit den Klägern nichts zahlen. Der Fall verdeutlicht das komplexe rechtliche Dilemma, wer bei einem Unfall haftet, wenn menschliches Versagen und technische Mängel zusammenkommen.
Das Urteil sendet ein klares Signal an die Automobilhersteller: Sie sind nicht nur für die Funktionalität, sondern auch für die sichere und ehrliche Vermarktung ihrer Fahrassistenzsysteme verantwortlich.
Folgen für die Zukunft des autonomen Fahrens
Experten sehen das Urteil als einen möglichen Wendepunkt für die gesamte Branche. Es könnte eine Welle ähnlicher Klagen nach sich ziehen und die Entwicklung von autonomen Fahrzeugen verlangsamen, da Unternehmen vorsichtiger mit Haftungsfragen umgehen müssen.
Der Fall könnte die juristischen Standards für teil- und vollautomatisierte Fahrzeuge neu definieren und die Hersteller dazu zwingen, ihre Systeme robuster zu gestalten und die Einschränkungen der Technologie transparenter zu kommunizieren.
Tesla hat angekündigt, Berufung einzulegen, da das Urteil ihrer Ansicht nach die Entwicklung lebensrettender Technologien gefährdet.